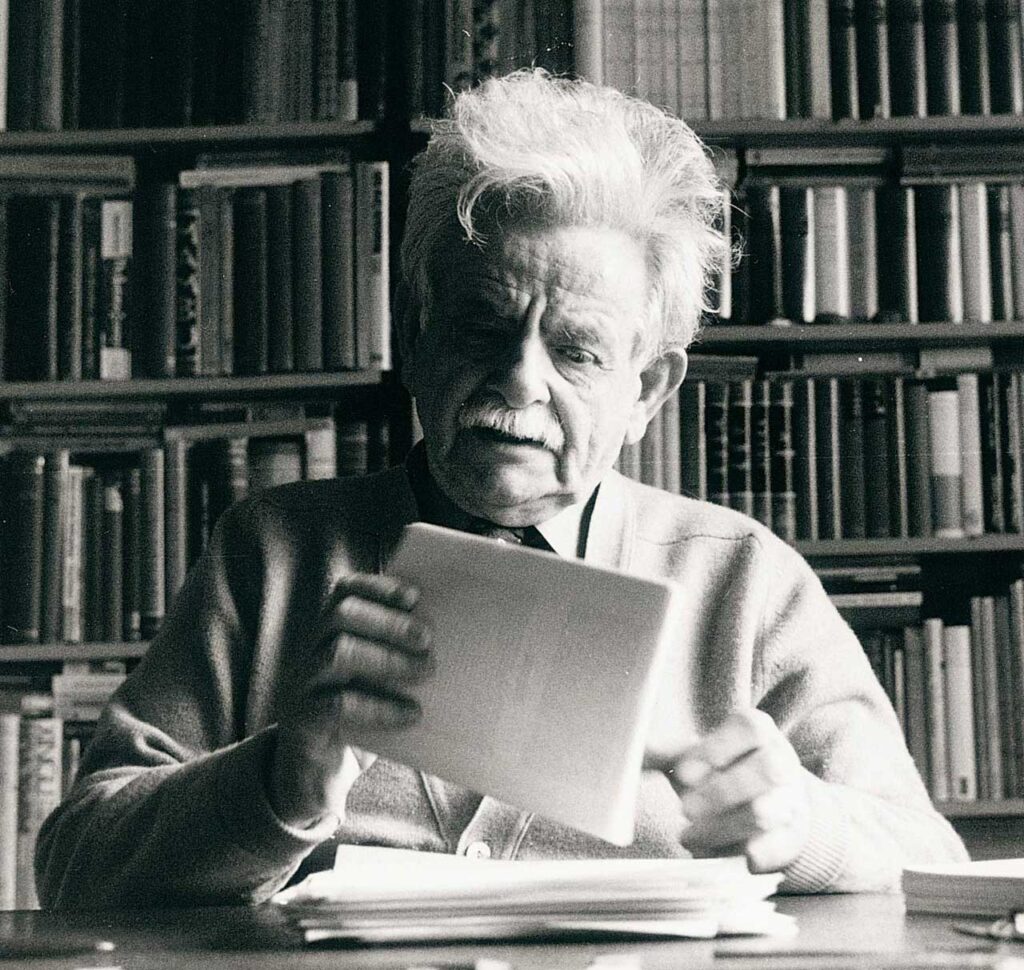
»Ein Krieg spielt sich immer so ab,
als wäre die Menschheit
auf den Begriff der Gerechtigkeit
noch überhaupt nie gekommen.«
»Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes.«
»Mein ganzes Leben ist nichts als ein verzweifelter Versuch, die Arbeitsteilung aufzuheben und alles selbst zu bedenken, damit es sich in einem Kopf zusammenfindet und darüber wieder eins wird.«
Mittwoch, 11. März 2026
Adoleszenz in Frankfurt
Wolfram Koch liest Texte von Elias Canetti Kristian Wachinger stellt die Zürcher Ausgabe vorMittwoch, 25. März 2026
Elias Canetti für die Gegenwart
Gespräch: Sven Hanuschek, Heide Helwig
Lesung: Katharina Lorenz
Moderation: Kerstin PutzDonnerstag, 9. April 2026
Heide Helwig spricht über Elias Canetti


